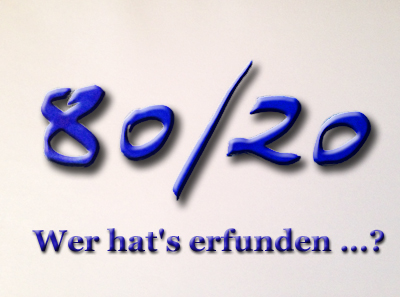Nein, nicht die Schweizer, wie uns ein Werbeslogan für Lutschpastillen seit Jahren suggerieren will, sondern im vorliegenden Fall der italienische Ökonom und Soziologe Vilfredo Pareto. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts beschrieb er das als Pareto-Prinzip oder 80/20-Regel bekannte Phänomen, nach dem sich innerhalb eines Projekts oder einer Aufgabe mit 20 Prozent Aufwand bereits 80 Prozent des gewünschten Ergebnisses erzielen lassen. Und um gekehrt für die verbleibenden 20 Prozent der Aufgabe 80 Prozent der Zeit aufzuwenden sind.
Klingt ein bißchen nach Finanzmathematik bis hierher. Das war es auch seinerzeit. Diese ökonomische Faustformel nimmt auch an, dass zum Beispiel in Firmen 20 Prozent der Kunden 80 Prozent des Umsatzes ausmachen.
80/20 lässt sich aber auch wunderbar aufs Üben anwenden. Weil’s so Spaß macht, grätsche ich ganz plaktiv mittenrein: Es gab mal eine Phase in meinem Leben – lang, lang ist’s her – da habe ich ein recht ordentliches Pensum aufs Üben verwendet. Eines Tages wurde ich kritisch. Was übe ich denn da die ganze Zeit? Wieso, warum und was soll das alles bringen? Mit Schrecken habe ich festgestellt, dass ich Signore Pareto schlimm überstrapaziert hatte. Nicht nur 80, sondern geschätzt wenigstens 90 Prozent meiner Übezeit – damals 3 bis 4 Stunden am Tag – habe ich nur, und ich meine ausschließlich damit verbracht, mir verwegene Solokonzepte in den Kopf reinzudrücken. Wenn das alles hängengeblieben wäre … mag garnicht weiterdenken. Aber in der Praxis, sprich: in der Band, habe ich nie und nimmer die laut Pareto nun fällig werdenden 20 Prozent mit Solospielen verbracht. Kurzum: ab und zu kommt in der Band ein kleines Solöchen vor und ich habe nahezu meine komplette Übezeit nur darauf verwendet. Was für eine Verschwendung!
Der gitarristsiche Pareto-Umkehrgedanke wäre nun, dass ich bestimmt 80 Prozent oder gar mehr der Zeit aktiven Musizierens mit Rhythmusgitarre verbringe, das jedoch nicht annähernd 20 Prozent meiner Zeit übe. Losgelöst von statistischer Verteilung und ökonomischen Merksätzen, ganz allgemein formuliert stelle ich fest, dass viele elektrifizierte Gitarristen (die sind wohl hauptsächlich davon betroffen) einen Großteil der Zeit darauf verwenden, irgendwann mal möglichst virtuos zu tönen, aber die Rhythmusgitarre, die den Löwenanteil in der Praxis ausmacht, sträflich vernachlässigen. Es sollte klar sein, dass ich hier über den gemeinen, aber ambitionierten Pop/Rock-Gitarristen parliere. Im Jazz ist nun mal der Soloanteil extrem hoch, keine Frage. Das will auch ausgiebig geübt werden. Und jeder, der mindestens so lässig mit chorusgetränkten Quartenvoicings umgehen kann wie Mike Landau, ist sowieso vom Rhythmus-Üben befreit 🙂
Das beschriebene Ungleichgewicht kann man auch in der Übeliteratur feststellen. Einfach mal beim Online-Bookstore oder im realen Buchladen Ihres Vertrauens recherchieren, wieviele Bücher es zum Thema Solospiel und Improvastion gibt und wieviele zum Thema Rhythmusgitarre. Eine deutliche Sprache!
Gegenmittel für dieses Solo-Übergewicht? Da fällt mir schon was ein: um dieses bisweilen recht nervige Höher-Schneller-Weiter-Syndrom etwas einzubremsen, mal die Lieblingsriffs, seien es die eigenen oder fremde, wirklich achtsam üben, im Bandkontext mal wirklich „locked“ mit Schlagzeug und Baß sein oder vielleicht auch allein mit dem vielgeschmähten Metronom die Dinger zum Leben erwecken. Die ganz Harten dürfen sich wenigstens 3, besser 5 Durchgänge für die Begleitung eines Jazzblues ausdenken. Tonart nach Wahl. Das kuriert. Garantiert.